Es ist wieder Zeit für Fluchtgeschichten. Auch ganz alte. Denn viele Deutsche haben augenscheinlich völlig vergessen, wie das ist, wenn Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen und am Ankunftsort unterwünscht sind und schikaniert werden. Auch Dieter Moselt kann so eine Geschichte erzählen. Zumindest ersatzweise. Denn als seine Familie aus dem Warthegau floh, war er selbst noch viel zu klein, gerade zwei Jahre alt. Warthegau? Ja, schreibt er so.
Dabei ist dieses Gebiet rechts und links der Warthe (polnisch: Warta) altes polnisches Siedlungsgebiet. Aber gerade deshalb wechselte es im Lauf der Jahrhunderte immer wieder den Besitzer. Mal waren es die Preußen, die sich hier breit machten, mal das zaristische Russland. Dann wieder war es für kurze Zeit wieder Teil des neu gegründeten Polen, bis 1939 die Deutschen einmarschierten und das Gebiet zwischen Schlesien und Pommern zum „Reichsgau Wartheland“ machten – mit Gauleiter und Umsiedlungspolitik und allen anderen Schikanen, die die Nazis für die einverleibten Gebiete im Osten auf der Liste hatten.
Dabei konnten sie auch auf über 300.000 Deutsche setzen, die hier bei einer Gesamtbevölkerung von 4,5 Millionen Menschen lebten. Und ein Teil kollaborierte eifrig mit den neuen „Herren“, andere versuchten, sich aus den Dingen herauszuhalten. In der Geschichte, die Moselt erzählt, geht der Riss mitten durch die Familie: Während der Vater Stans versucht, ein einigermaßen anständiges Leben zu führen, ist dessen Bruder zum stahlharten Nazi geworden und hat auch die polnischen Widerstandskämpfer im Ort verraten. Logisch, dass die Polen nach der Befreiung durch die Sowjetarmee auf Rache sinnen und den Verräter suchen. Aber wie das so ist mit Nazis: Wenn es um die Abrechnung geht, sind sie immer verschwunden, haben sich frühzeitig in den Westen abgesetzt (so wie auch Gauleiter Arthur Greiser) und sind damit nicht mehr erreichbar. Was für Stans Vater zum Problem wird, als die Polen den Namen des Schuldigen haben wollen – aber eines Schuldigen, den sie noch bestrafen können. Was in der Dramatik dieser Zeit natürlich wieder bedeutet, dass zwei Unschuldige zum Opfer werden und Stans Familie nicht nur das Wissen um dieses Versagen mit sich nimmt, als ihr endlich die Flucht Richtung Breslau gelingt, sondern auch den nun elternlosen Josef, der für Stan zum kleinen Bruder wird.
Eindrucksvoll erzählt Moselt, wie es der kleinen Familie nach ihrer Ankunft gelingt, sich anfangs in ärmlichsten Verhältnissen einzurichten und sich nach und nach ein klein wenig Sicherheit und Wohlstand zu erarbeiten. Die Schwierigkeiten, in einem kleinen niedersächsischen Dorf Fuß zu fassen, werden erzählt, die Probleme in der neuen Schule in der großen Stadt, wo die Kinder wieder Außenseiter sind. Die Einheimischen begegneten Flüchtlingen aus dem Osten im Grunde mit denselben Vorurteilen und Bosheiten, mit denen später auf jede andere Art von Einwanderung auch reagiert wurde. Das wiederholt sich augenscheinlich in immer neuen Schleifen und es dauert lange, bis die Gräben geschlossen sind und die Neuankömmlinge selbst zum Teil einer Gesellschaft geworden sind, die sich verändert hat, da und dort auch ein Stück weit offener geworden ist für das Fremde, dem die beiden Jungen bei einer kleinen Liebeserfahrung in den Ferien begegnen. Doch die geht am Ende tragisch aus.
Ganz verschwunden sind die Erinnerungen an die dunklen Vorfälle in der Kindheit nicht. Wenn es drauf ankam, ging der große „Bruder“ für den Kleinen auch mal zum Äußersten – auch wenn er nach dem Vorfall mit dem pädophilen Lehrer nicht wirklich weiß, ob er da nun Schuld auf sich geladen hat. Und wie viel. Denn auch wenn der Vater in der Geschichte oft als schwach und nicht standhaft erscheint, können die beiden Jungen am Ende nur feststellen, dass er wohl doch anders war als die meisten Männer in dieser Generation. Geschlagen hat er die Jungen nie.
Und so steckt auch dieser Stan, der bewusst einen anderen Namen angenommen hat, um nicht mit seinem Nazi-Onkel verwechselt zu werden, nicht voller Rachegefühle, auch wenn er sich am Ende – nach einem langen Gespräch mit Josef – auf die Suche nach dem Schuldigen an Josefs Lebenstragödie aufmacht, nicht ahnend, dass er im fernen Namibia einem alten Mann begegnen würde, der nicht ein bisschen bereit ist zu bereuen, was er getan hat, und der immer noch von der Überlegenheit der weißen Rasse redet und scheinbar so eine Art Wohltäter der ganzen Region geworden ist. Die verbale Begegnung wird regelrecht zur Niederlage, weil Stans Vorwürfe an der eisigen Wand der Selbstgerechtigkeit abprallen. Ein Moment, das einen doch erstaunlich an die moderne Arroganz der ewigen Chauvinisten erinnert: Sie leben in einer Welt, in der Schwäche, Verständnis, Menschlichkeit keinen Platz haben. Verächtlich schauen sie auf die scheinbar so weichen und willensschwachen „Gutmenschen“ herab (haben wir schon geschrieben, dass das Wort aus dem Nazi-Wortschatz stammt?), genauso, wie sie es heute wieder in sozialen Netzwerken und auf arroganten Demonstrationen tun. Für das Schicksal ihrer Mitmenschen interessieren sich diese Leute nicht, auch Stans eisiger Onkel tut es nicht. Er reagiert nicht mal, als sein Neffe ihm entgegen wirft: „Doch eines Tages holt dich der Teufel!“
Dafür stellt er sich hochnäsig zum Foto auf, dicht am zweitgrößten Canyon der Welt, labert einfach weiter und versucht dem Neffen klar zu machen, dass Hitler nur die Schweiz hätte erobern müssen, dann hätte er den Krieg gewonnen. Und dann stürzt er in einem Moment der Unachtsamkeit über die Felskante, kann noch geborgen werden. Aber seine letzten Worte sind genau das, was Stan nicht erwartet hatte. Denn dieser eingebildete Onkel zeigt mit dem Finger auf ihn und beschuldigt ihn, ihn über den Felsen gestürzt zu haben.
Dieter Moselt lässt die Sache noch einmal glimpflich ausgehen. Auch mit jener kleinen notwendigen Ent-Täuschung, die dem Wohltäter Namibias am Ende auch diesen Glorienschein noch entzieht. Aber schon der nächste Fetzen Zeitung, der Stan vor die Füße wedelt, zeigt ihm, dass die Welt voller falscher Onkel ist, überheblicher Mistkerle ohne Herz und Verstand, denen es trotzdem gelingt, sich als Wohltäter und Retter aufzuspielen und andere Menschen wie Marionetten an ihren Fäden tanzen zu lassen. Da schrumpft auch der Trost, einer brandgefährlichen Situation gerade so entkommen zu sein, schnell auf Erbsengröße zusammen, die Freude, eben noch hilfreichen Menschen begegnet zu sein, erstarrt in der Wahrnehmung, dass die von eiskalten Männern entfesselten Kriege nie aufhören. Und das ist auch möglich, weil die falschen Werte regieren: „Und auf der Werteskala kommt die Liebe weit nach der Coca Cola“.
An der Stelle endet die Geschichte, die wie eine Erinnerung daherkommt, eine der vielen Erinnerungsgeschichten, die auch die Kinder der einstigen Flüchtlinge mittlerweile schreiben, um ein Stück ihrer Familienüberlieferungen zu bewahren. Geschichte im Kleinen, oft stark reduziert aufs persönliche Schicksal. Dass aber am Anfang die eisigen Täter waren, die alle Tragik erst in Gang gebracht haben, steht nicht immer da. Hier wird es thematisiert, und auch wenn der alte Schlager „Sag mir, wo die Blumen sind“ anklingt, weiß der Erzähler in diesem Fall, wer es getan hat. Nur dass sich die Begegnung dann wie eine Niederlage anfühlt – wieder mal. Weil man mit dem Wunsch nach Menschlichkeit und Gerechtigkeit die eisige Schale der Täter nicht zu durchdringen vermag.
Dieter Moselt Wie die Erinnerung im Wind, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2016, 12,90 Euro.
In eigener Sache
Jetzt bis 13. Mai (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien, wie zB. T-Shirts von den „Hooligans Gegen Satzbau“, Schwarwels neues Karikaturenbuch & den Film „Leipzig von oben“ oder den Krimi „Trauma“ aus dem fhl Verlag abstauben. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
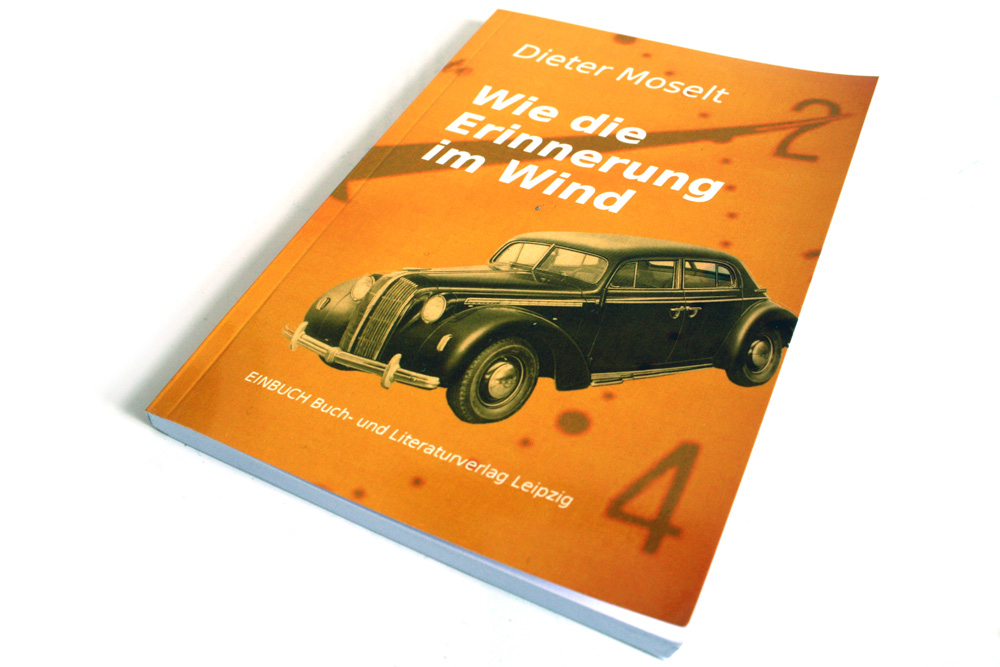








Keine Kommentare bisher