Warum kam es 2008 zum Beinahe-Crash des internationalen Finanzsystems, zu dem, was wir heute so lax "die Finanzkrise" nennen? Was ist da passiert? Waren Zocker, Spinner, Ganoven dran schuld? Übermütige Banker, die sich an keine Regeln mehr halten? Joris Luyendijk, studierter Ethnologie und Journalist aus den Niederlanden wollte es gern wissen. Der "Guardian" machte es möglich.
Der Chefredakteur des “Guardian”, Alan Rusbridger, machte es möglich, dass Luyendijk sich dem Moloch “Londoner City” auf ähnliche Weise widmen konnte, wie er sich zuvor schon dem Thema E-Mobilität gewidmet hatte. Beides sind für Laien völlig fremde, undurchschaubare Welten. Die meisten Journalisten merken nicht einmal, dass sie vom Thema eigentlich keine Ahnung haben. Obwohl Luyendijk in London schnell merkte, dass einige Kollegen der berichtenden Zunft sogar noch stolz darauf waren, von der Materie Finanzwirtschaft keine Ahnung zu haben: Fröhlich kolportierten sie die Geschäftsberichte der großen Bankhäuser, feierten die Manager wie Helden und waren ansonsten ganz froh, dass auch die Leser in der Regel nicht mehr wissen wollten. Und wollen.
Wie aber geht man mit einem Thema um als Journalist, wenn man davon (noch) keine Ahnung hat? Man tastet sich heran. Von ganz unten her, sucht sich Gesprächspartner und stellt ihnen erst einmal die einfachsten Fragen, um so langsam herauszufinden, worum es geht. Der kleine Unterschied zwischen E-Auto-Experten und Bankern ist: Die Ersten sind nur allzu bereit, die Sache zu erklären. Auch dem technischen Laien. Und weil Luyendijk als technischer Laie fragte, konnte er seine Leser mitnehmen in die bizarre Welt der Elektromobilität. Das hatte auch Rusbringer fasziniert. Und natürlich war auch ein Eigeninteresse des “Guardian” dabei, als er Luyendijk vorschlug, dasselbe mit den Bankern der Londoner City zu machen. 2011 war das. Die Krise war gerade drei Jahre her. Aber wer sich das Handelsparkett und die Auftritte der Finanzmanager anschaute, der hatte schon damals das Gefühl, dass sich eigentlich nichts geändert hatte.
Luyendijk startete seinen Blog. Und er begann seine Fühler auszustrecken in den dunklen Kosmos der Banken und nach Ansprechpartnern zu fragen. Er merkte schnell, dass das so einfach nicht war. Banker reden nicht gern über das, was sie tun. Und die Leute am Finanzplatz London erst recht nicht. Trotzdem gelang es Luyendijk im Lauf der Zeit, rund 200 Interviews zu führen, von denen 100 auch auf seinem Blog veröffentlicht – und teilweise heftig – diskutiert wurden. Er blieb seiner Methode dabei treu und schildert in seinem Buch, das er nun aus dem bis 2013 gewonnenen Material erstellt hat, wie er sich langsam überhaupt erst einmal die Strukturen der Londoner Bankwelt erschloss, all die komplexen Gebilde aus Kundenbanken, Investmentbanken, Wirtschaftsprüfern, Anlageberatern, Börsenhändlern, inneren und äußeren Controllern. Immer mit der Frage: Warum hat das dazu geführt, dass es 2008 beinahe schief gegangen ist?
Dass er dabei vielen sympathischen und auch auskunftsfreudigen Menschen begegnen würde, damit hatte er nicht unbedingt gerechnet. Und nach den ersten Interviews war er durchaus im Zweifel, ob er den Ursachen für den Beinahe-Crash von 2008 überhaupt auf den Grund kommen könnte. Bestien und Zocker waren das alles nicht. Ganz zu schweigen davon, dass sich die Bankenwelt als eine Welt mit unterschiedlichsten Arbeitsfeldern erwies und mit straffen Hierarchien. Titel werden geradezu üppig vergeben. Und nicht jeder, der sich im Bankensektor verdingt, ist dort aus Gier oder Ehrgeiz unterwegs. Kontrollen gibt es auch. Irgendwie. Doch je mehr sich Luyendijk in die Materie vertiefte, um so deutlicher wurde ihm, dass mit dem System etwas nicht stimmte. Und nicht stimmt. Denn geändert hat sich ja nichts. Irgendwann fand er den Alptraum vom leeren Cockpit als beste bildliche Darstellung dessen, was er bei seinen Recherchen vorfand: eine Mega-Maschine, in der die Bankenvorstände schon längst nicht mehr wissen, wie der Laden funktioniert, ganz zu schweigen von den mathematisch hochkomplexen Produkten, die sich ihre “Quants” ausgedacht haben, um immer höhere Umsatz- und Gewinnziele mit allen Finessen, die im gesetzlichen Rahmen möglich sind, zu erreichen.
Die Universalbanken, die die internationalen Finanzmärkte dominieren, sind längst zu groß, um Pleite gehen zu dürfen, “to big to fail”, wie es im Jargon heißt. Von den Vorstandssprechern wird schon längst nicht mehr überschaut, was welche Abteilung eigentlich tut. Dazu sind diese Kolosse seit den 1990er Jahren viel zu sehr gewachsen und haben auch Teile des Finanzsektors geschluckt, die bis dahin komplett eigenständig waren – wie das komplette Investmentbanking, das die großen Banken in den 1990ern als wahre Gelddruckmaschine für sich entdeckten und in die eigenen Bankhäuser integrierten. Aus geachteten und erfolgreichen Investmentbanken, in denen die Bankeigner persönlich für Gewinn und Verlust hafteten, wurden auf einmal bankinterne Abteilungen, die zur Gewinnmaximierung eingesetzt werden konnten. Auf einmal waren die Einlagen der Bankkunden die Basis, auf der immer kompliziertere Finanzprodukte in die Märkte gedrückt werden konnten.
Und der Druck wuchs. Denn sämtliche der großen Universalbanken sind börsennotiert. Sie sind nicht mehr dem kaufmännischen Denken eines haftenden Eigners verpflichtet, sondern dem Dividende-Druck der Aktionäre. “Shareholder Value” heißt das. Und das bedeutet auch bei jeder nicht so hohen Gewinnmarge, dass die Kurse an der Börse nachgeben. Aber wie erzielt man immer höhere Gewinne in zweistelligen Bereichen? Man erfindet neue Produkte, die man seinen Kunden andreht, am besten so, dass die eigenen Risiken praktisch nicht mehr existieren. CDS und CDO zum Beispiel, den Leipzigern mittlerweile bestens im Zusammenhang mit der KWL bekannt.
Aber spielt Moral im Finanzsektor überhaupt eine Rolle?
Mehr dazu gleich an dieser Stelle.
Joris Luyendijk “Unter Bankern. Eine Spezies wird besichtigt“, Cotta’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 2015, 19,95 Euro
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
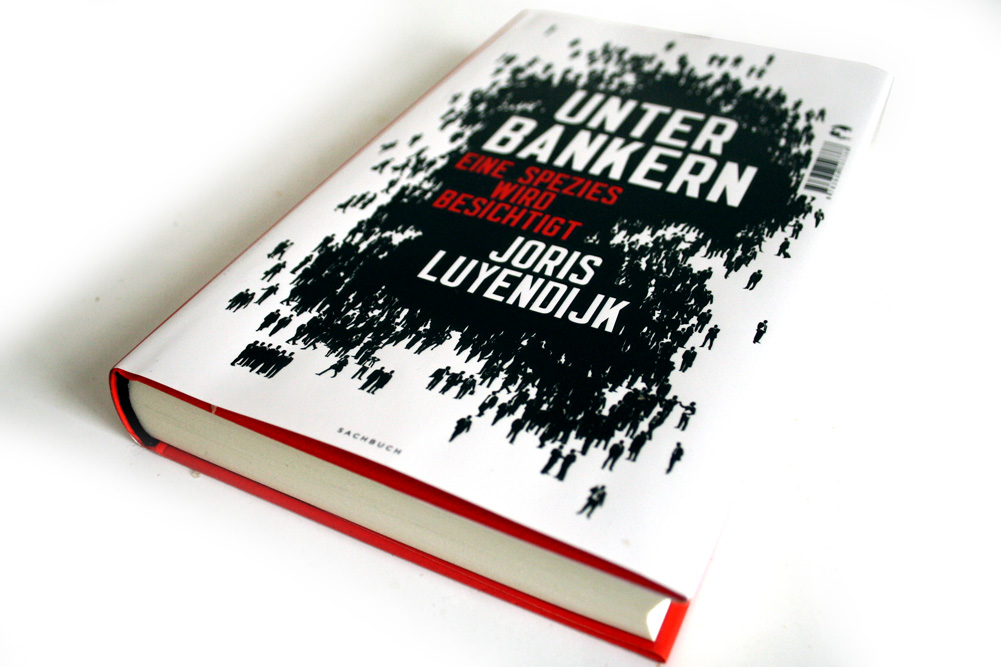








Keine Kommentare bisher