Was sind denn nun, bitte schön, Gedichte? Was ist Dichtung? Was stellen Dichter an? Sind sie etwas Besonderes? Eine eigene Spezies Mensch mit einer ganz eigenen Beziehung zur Welt und zur Sprache? - Manchmal, ganz selten, merkt man, dass es dem ein oder anderen Dichter gelingt. Aber ist das Begabung, Genie, ein besonderer Draht? - Walter Thümler hat von berufswegen darüber nachgedacht. Er ist selber Gedichteschreiber und Übersetzer.
Lebt an der Elbe. Und wünscht sich innigst, dass Poesie etwas Besonderes ist. Und der Dichter auch, wenn er schon nicht reich wird von seinem Schreiben. Wer sich ins Prekäre wagt, lebt prekär. Und wer dichtet, muss ins Prekäre. Es hilft alles nichts. Denn eines wird einem, wenn man so einige hundert Gedichte gelesen hat, klar: Oberflächlichkeit entlarvt sich. Die kleine Form zwingt zur Präzision, zum genauen Wort, zum sauberen Klang.
Was nicht verhindert, dass die Märkte geschwemmt sind mit Hingeschludertem, Drauflosgereimtem, Plagiiertem, Gekünsteltem. Deutschlehrer glauben zwar, sie könnten ihren Schülern vermitteln, worum es dabei geht. Aber sie können es nicht wirklich. Dazu bieten die Lehrpläne viel zu wenig Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Kern von Dichtung – nicht Gott, wie Thümler meint, für den Dichtung Liturgie ist, ein religiöser Akt.Der Kern jedes gelungenen Gedichts ist die Sprache. Die ganz konkrete. An einer Stelle seiner “poetologischen Notizen” spricht Thümler von “entleerten Worten”. Was ein Unding ist. Es gibt keine leeren Worte. Und auch der Dichter füllt Worte nicht mit Bedeutung. Auch wenn er Bedeutungen und “Wortinhalte” verstärken kann. Bis sie leuchten, glühen, brennen. Das kann so Manchen, gerade wenn er selbst tief religiös ist, dazu animieren, in der Dichtung die Begegnung mit Gott zu sehen. Mit seinem Gott. Oder dem, was er sich drunter vorstellt.
Aber was ist Dichtung, wenn sie für die Dichter kein Gottesdienst ist? Wenn sie das Hinarbeiten auf eine religiöse Vision nicht brauchen? – Es wäre zu wünschen gewesen, wenn Walter Thümler sich einfach die Mühe gemacht hätte, öfter “ich” zu schreiben. Es ist seine Poetologie, die er hier vorlegt. Eine aus tiefem Glauben geborene. Im Zentrum eine katholische Vorstellung von Welt – so, wie es im Griechischen “katholikós” gemeint ist: um des Ganzen willen.
Was draus wird: Gedichte wie Tagebucheinträge – mit einem erschrockenen Ich
Mit 66 Jahren – singt da einer …
Der rostende, sich zersetzende Klotz der ‘Vereinigten Staaten’: Die langen gebrochenen Zeilen des C. K. Williams
Gähnende Leere im Online-Buchladen …
Gennadij Ajgis spröde Gedichte: Immer anders auf die Erde
Es hätte des Hinweises auf Kasimir Malewitsch …
Was immer einen Versuch wert ist. Und so selten klappt. Denn die Sprache, die wir benutzen, ist eine benutzte Sprache, bis zur Plattheit abgeschliffen, Geplapper, Lärm, Lüge, Verstellung, Oberflächlichkeit. Auch das Meiste, was geschrieben wird, ist Lärm und Geschwätz.
Wenn Gedichte gut sind, lösen sie sich davon, schaffen Konzentration und Stille, lassen den Leser auftauchen aus dem unbedachten Gebrabbel und wieder wahrnehmen. Was Arbeit macht. Dem Dichter, der sich immer wieder neu vergewissern muss: Was tue ich? – Sollte zwar jeder machen, der ein Amt bekleidet, und sei’s ein freiwillig gesuchtes. Aber bei Dichtern fällt es auf, wenn sie schludern. Wenn das, was sie sagen wollen, unter falschen Worten, Bildern, Wendungen verschwindet, wenn sie sich ablenken lassen. Sprache ist voller Ablenkungen. Worte werden missbraucht, manche sind überfrachtet mit falschem Schein, manche abgenutzt und geradezu blass.
Dass etwas Seltsames passiert, wenn ein Gedicht einrastet und zündet, beeindruckt auch die Dichtenden. Da passiert etwas, was über das Gewollte hinaus geht, wo hinter dem glasklar gefassten Bild ein anderes auftaucht, ein neues Leuchten, ein verblüffendes Erstaunen. Für Thümler hat Poesie “eine Verwandtschaft zur Liturgie”. Auch wenn man beim Lesen merkt, wie er immer wieder den Kopf schüttelt und merkt, dass der religiöse Kontext eigentlich zu eng ist und nicht alles fasst. Denn wie bekommt man die “Vergegenwärtigung” unter in dieser Überlegung, das, was Gedichte ja erst verblüffend macht: dieses ganz dicht dran sein an unserem Hier? Dieses Herausgerissenwerden aus dem täglich empfundenen Fremdsein?Thümler versucht das mit dem französischen Philosophen Levinas zu fassen. Es funktioniert nicht. Nicht wirklich. So kommen zwar Gedicht und Gebet in nahe Verwandtschaft. Aber Gedichte sind nur manchmal Gebete – und sonst alles Mögliche. Vielleicht hat Thümler von Levinas diesen dozierenden Ton. Wenn Philosophen dozieren, werden sie unerträglich. Und merken nicht mal, wenn sie sich im Kreis drehen. Der Dichter ist kein “von der Sprache Erwählter”. Es klingt so schön. Ist aber falsch. Wenn er gut ist, der Bursche, dann hat er ein Gespür für unsere Sprache, für die Wörter und ihre Beziehungen, für dieses Gewebe, mit dem wir sagbar machen, was uns bewegt, verstört, beeindruckt, beschäftigt. Dichter sind keine Priester, sondern – das vergessen sie oft – Arbeiter im Wortwerk.
Darüber wurden schon Berge von Büchern geschrieben, tausende Essays.
Da ordnet sich Thümlers Versuch ein, sein Verhältnis zur Dichtung, zur Sprache, zur Welt zu beschreiben. Es bleibt ein bisschen – naja – transzendent. Was durchaus möglich ist. Es gibt auch faszinierende Dichtungen, die so versuchen, unser So-Sein zu fassen. Und manchmal kann man das, was uns in scheinbar leicht hingetupften Texten verblüfft, wie eine Transzendenz empfinden, als dieses erstaunliche Mehr, das wir auch mit der sechsten und siebenten Erläuterung nicht fassen können. Was eigentlich nur deutlich macht, was Sprache kann, wenn man sie beherrscht. Aber das ist Arbeit und Profession und Gespür, keine Liturgie.
Wirklich nicht.Es ist eine ganz persönliche Poetologie. Übrigens ohne Vögel, so sehr der Ornithologe hier auch in Verlegenheit ist. In manchen Notaten wird spürbar, woran Thümler scheitert. “Das Wort ist leer, sobald es von seinem sinnstiftenden Quell abgezogen ist. – Wie aber finden wir zum sinnstiftenden Quell zurück?”.
![]()
Die Verlegenheit des Ornithologen
Walter Thümler, Leipziger Literaturverlag 2013, 12,95 Euro
Auch dieses “Wir” ist ein Ich. Das man hier so sehr vermisst. Und den “sinnstiftenden Quell” gibt es natürlich auch nicht. So wenig wie den Heiligen Gral. Dichten bleibt Arbeit und Schinderei und Suche und Immer-wieder-neu-Anfangen. Da kann man dem Dichter wirklich nicht helfen. Hinterher fragt der Leser ganz bestimmt nicht, wie der Poet sich geschunden und gequält hat, worauf der gar verzichtet hat. Das möchte der Dichter wohl gern. Aber mal ehrlich: Wer hat Mitleid mit der Schinderei der Dichter? – Verschenkt euch, meine Damen und Herren. So, wie wir unbegabten Menschen es auch tagtäglich tun. Und wenn ihr gut seid, flechtet man euch einen schönen Lorbeerkranz oder kauft eure Bücher.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
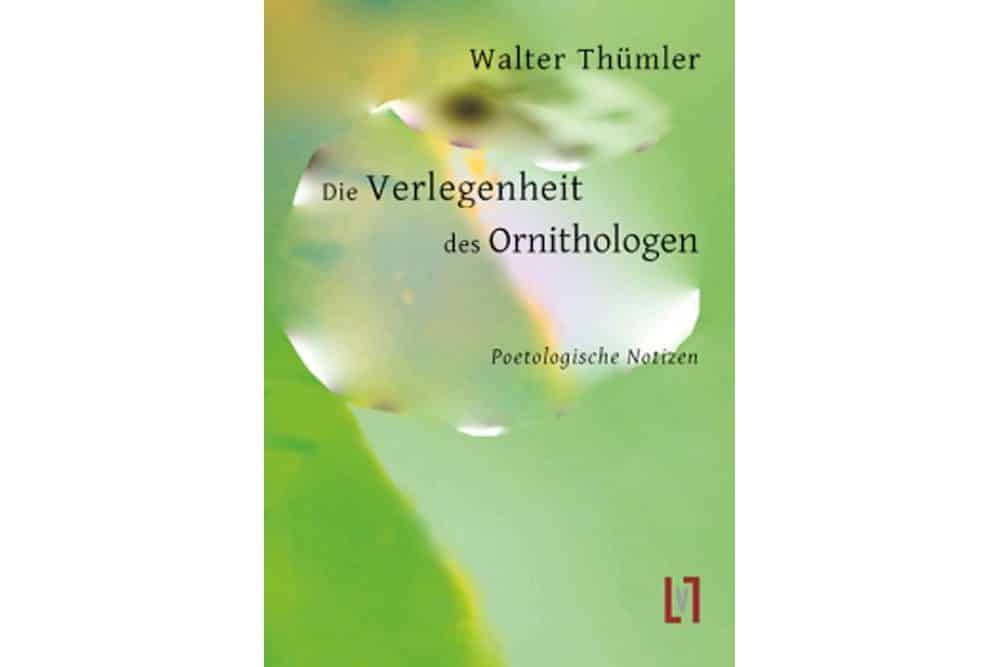



Keine Kommentare bisher